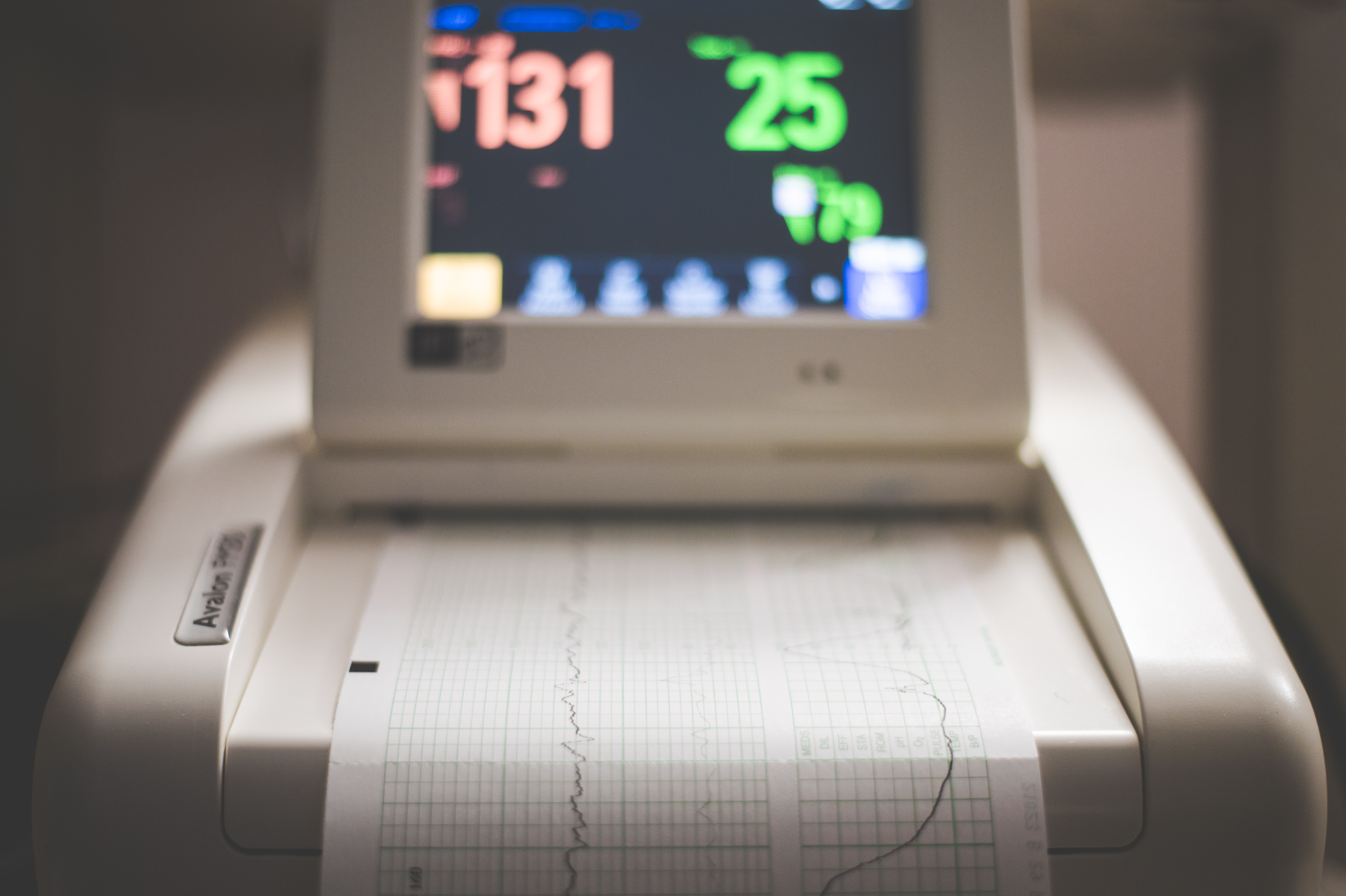Das Kunstherz ist eines der ältesten künstlichen Organe und wird seit über 50 Jahren als Übergangslösung eingesetzt. 1969 entwickelte der argentinische Arzt Domingo Liotta das erste Kunstherz, das einem Patienten am Texas Heart Institute implantiert wurde. Der Patient überlebte drei Tage damit, verstarb jedoch nach der Transplantation eines Spenderherzens.
Heute überbrückt das Kunstherz die Wartezeit auf ein Spenderherz, die viele Jahre dauern kann. Es unterstützt das natürliche Herz, birgt aber Risiken wie Infektionen oder Schlaganfälle. Fortschritte wie die Hightech-Pumpe „Carmat Aeson“ zeigen, dass das Kunstherz in Zukunft auch als dauerhafte Lösung für herzkranke Patientinnen und Patienten dienen könnte. Ein Team der Herzchirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg hat zwei Patienten Mitte 2024 die Kunstherzen Carmat Aeson eingesetzt. Das Besondere: Die Kunstherzen unterstützen dabei nicht die natürliche Herzfunktion, sondern übernehmen diese komplett. Die Hydraulikpumpe, die größer ist als ein natürliches Herz und etwa 3-mal so schwer, wird in den Brustkorb eingesetzt, ähnlich wie bei einer Herztransplantation. Sie wird mit den großen Blutgefäßen und den Herzvorhöfen verbunden, bevor der Brustkorb wieder verschlossen wird. Ein Kabel zur Stromversorgung bleibt jedoch außen und verbindet das Kunstherz mit den Akkus, die der Patient in einer Umhängetasche trägt.
Derzeit gibt es nur zwei künstliche Herzen (THA), die auch als jene zugelassen sind. Das etwas ältere SynCardia-System wurde in den USA entwickelt und ist weltweit zugelassen. Das Carmat Aeson ist momentan nur in Europa zugelassen.